Wer wir sind und wen wir mögen, sind sehr persönliche Fragen, die einem nicht nur am Weg ins Erwachsensein beschäftigen. Die Geschlechteridentität (auch sexuelle Identität genannt) gilt als Ausdruck dessen, wie wir uns selbst sehen und wie wir von anderen Personen wahrgenommen werden möchten. Lange Zeit gab es die Auffassung, dass Geschlecht sich nur anhand von körperlichen Merkmalen, die bei der Geburt festgelegt werden, bestimmen lässt. Neben körperlichen und biologischen Geschlechterzuordnungen spielen aber auch soziale und kulturelle Vorstellungen über Geschlecht und Sexualität eine wichtige Rolle für unsere (sexuelle) Identität.
Identität, Sexualität und Geschlechtervielfalt
Sexualität und Geschlecht
Haarschnitt, Kleidung sogar der Gang eines Menschen können herangezogen werden, um Geschlechter einzuteilen. Doch Geschlechteridentitäten sind nicht von Äußerlichkeiten bestimmt, sondern von vielen Faktoren abhängig. Sie werden von uns selbst festgelegt und können auch offengelassen werden. Das Bewusstsein für Geschlechtervielfalt wächst und bereichert unsere Gesellschaft. Festgefahrene Rollenzuschreibungen und stereotype Körperbilder können so unterlaufen und hinterfragt werden.
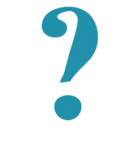
Nachgefragt: Binär und Nonbinär
Beim Songcontest 2024 wurde heftig diskutiert. Der Schweizer Gewinnertitel „The Code“ wurde von Nemo gesungen. Nemo bezeichnet sich als nonbinär. Das bedeutet, Nemo möchte sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuteilen lassen. Während binär die Vorstellung von zwei Geschlechtern (Mann/Frau) beinhaltet, möchten nonbinäre Menschen diese starre Zweiteilung der Geschlechter aufbrechen.
Unsere Geschlechterzugehörigkeit ist nicht nur von biologischen Merkmalen bestimmt, Vorbilder, Regeln, Erwartungen prägen unsere Vorstellung von Geschlecht von Kindheit an. Oft beziehen sich diese Vorstellungen von Geschlecht auf die Unterscheidung zwischen „Männern“ und „Frauen“. Viele Aussagen, Floskeln oder Klischees in Alltag und Werbung werden mit dieser Zweiteilung verbunden: Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mögen Dinosaurier. Männer schauen am liebsten Fußball, Frauen können nicht einparken. Damit einher gehen auch Rollenzuschreibungen und sogar Berufsentscheidungen. Was als typisch männlich und typisch weiblich angesehen wird, kann sich aber auch verändern. Ein Beispiel dafür sind Farbzuschreibungen. Noch vor 100 Jahren war die Farbe blau den Mädchen vorbehalten, heute werden bei Kleidung, Spielzeug und Werbung oftmals Mädchen mit rosa oder hellen Farben verbunden, Jungs mit blauen und gedämpften Farben.
Änderung der Geschlechterzugehörigkeit
In der Geburtsurkunde wird das vom medizinischen Personal oder den Eltern kurz nach der Geburt bekanntgegebene Geschlecht eingetragen. Diese Eintragung kann nachträglich geändert werden. Seit 2009 braucht es für eine Änderung der Geschlechterzugehörigkeit keine geschlechtsangleichende Operation. Die Änderung des Geschlechtereintrags wird als Personenstandsänderung bezeichnet. Dafür sind die Standesämter der jeweiligen Bundesländer zuständig. Wer sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlt, kann ein anderes Geschlecht angeben. Dieses „3. Geschlecht“ lautet dann: offen, divers beziehungsweise inter oder es wird keine Angabe gemacht.

Auf den Punkt gebracht: Ehe für alle
Eine Beziehung zwischen zwei Menschen kann durch eine Heirat oder Verpartnerung öffentlich gemacht werden. Eine Heirat ist für alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht ab dem 16. Lebensjahr erlaubt. In Europa gibt es in 22 Ländern die Ehe für alle. Außerhalb Europas sind es 16 Länder.
LGBTQ und mehr
So bunt wie der Regenbogen sind die Menschen, ihre Kleidung, ihr Aussehen und ihre Liebesbeziehungen. Wen Menschen lieben und welchem Geschlecht sich Menschen zugehörig fühlen kann ganz unterschiedlich sein. In vielen Ländern werden Menschen dafür, wen sie lieben und ob beziehungsweise welchem Geschlecht sie sich zuordnen, angegriffen. Umso wichtiger ist es für eine offene und vielfältige Gesellschaft einzutreten. In einem Drittel der Länder weltweit werden LGBTQI+-Personen gesetzlich diskriminiert, in ebenso vielen Ländern der Welt sind gleichgeschlechtliche Beziehungen strafbar. Nur in 58 Ländern (darunter auch Österreich) werden Menschen vor Verbrechen und Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung gesetzlich geschützt.
LGBTQIA+
Und noch mehr: Viele Menschen geben in ihren Social Media Profilen den Begriff „pansexuell“ an (das griechische Wort „pan“ steht für „gesamt“). Wen sie lieben ist also nicht von Geschlechterzugehörigkeiten abhängig.
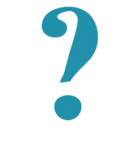
Nachgefragt: Kann eine geschlechtergerechte Sprache zur Gleichbehandlung der Geschlechter beitragen?
Sprache und Schrift halten viele Möglichkeiten bereit die Vielfalt der Menschen auszudrücken. Lange Zeit war es aber üblich, lediglich die männliche Form zu benutzen. Es wurde von Ärzten, Polizisten oder Schülern gesprochen, damit sollten sich alle Personen angesprochen fühlen. Was man nicht sagt oder schreibt, wird aber oftmals nicht wahrgenommen und als gleichberechtigt anerkannt. Heute ist es üblich, zumindest die weibliche und männliche Form zu verwenden und von Ärzten und Ärztinnen zu sprechen oder vor dem i eine Pause zu machen (/aɛɾtstɪnnən/). Der Vielfalt der Geschlechter wird auch durch Ergänzungen wie „_“ „:“ oder „*“ Rechnung getragen. Diese Ausdrucksweise wird als „gendern“ (vom engl. Wort für „Geschlecht“) bezeichnet


